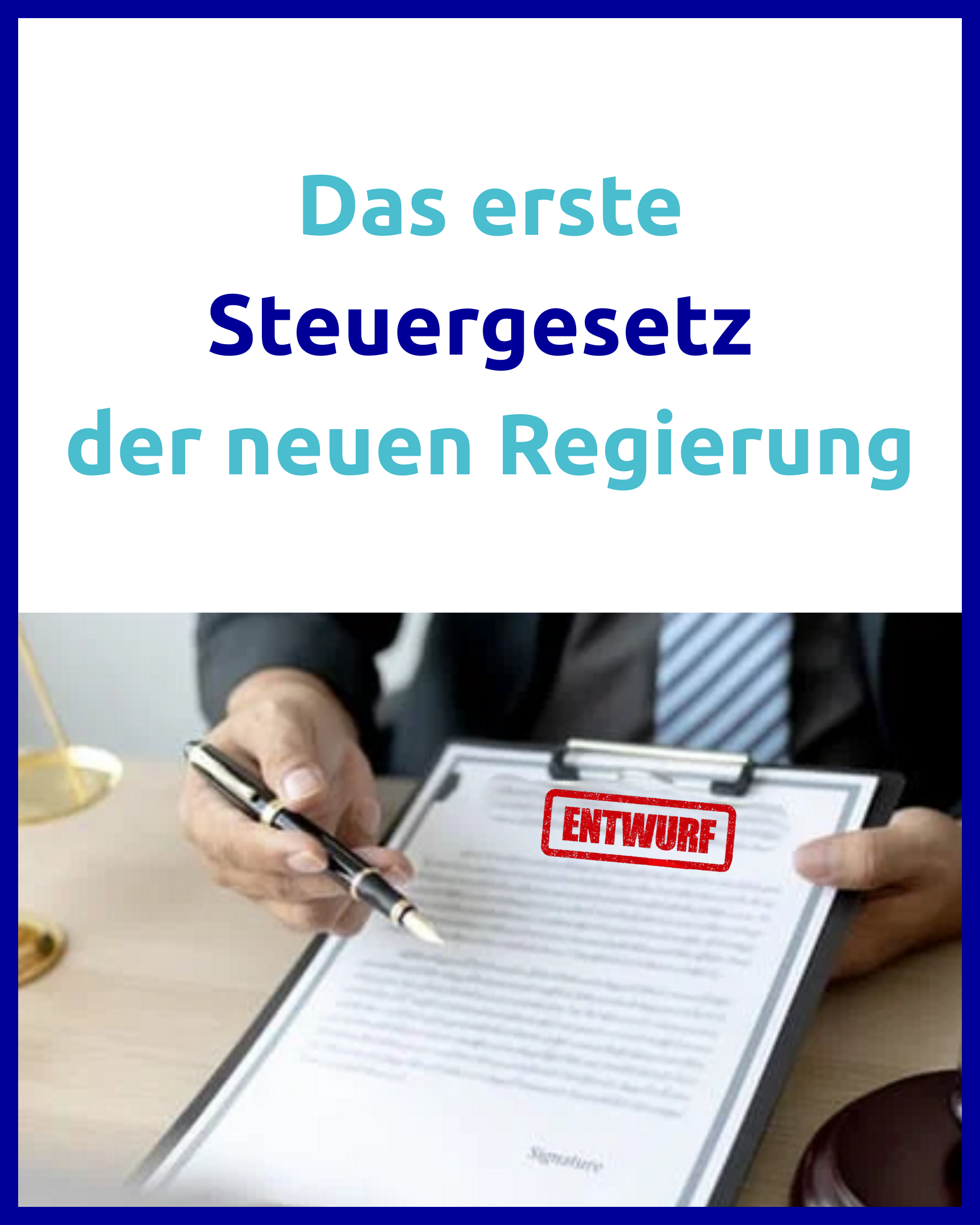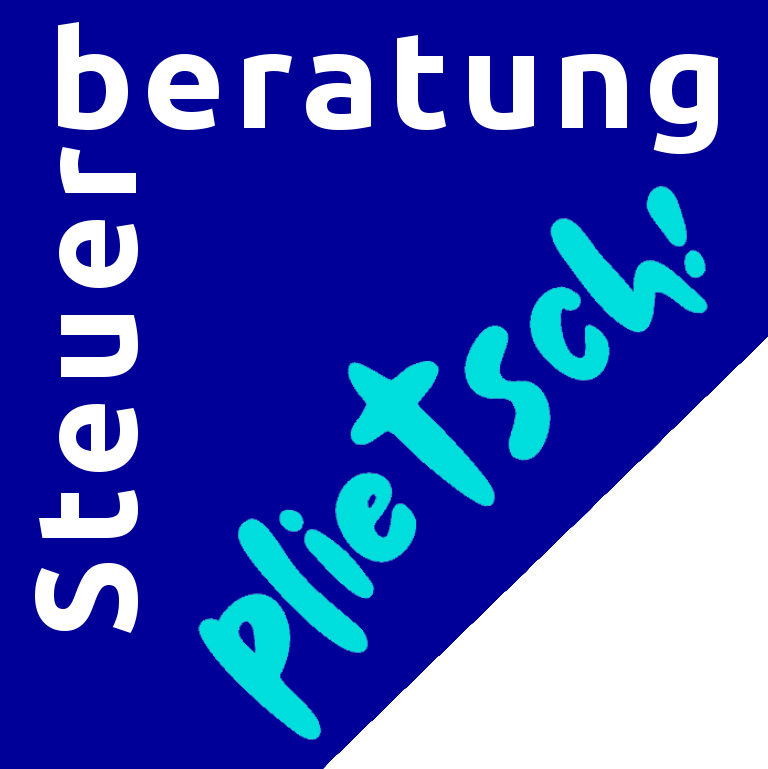Die Einführung der digitalen Rechnung (eRechnung) als Instrument zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen steht vor neuen Entwicklungen durch die Vorgaben der EU. Die geplante Einführung im Jahr 2028 mit begleitendem Reporting wirft bereits jetzt Fragen auf. Deutschland strebt derzeit eine nationale Regelung bereits ab 2025 an. Da rechtliche und technische Vorgaben noch fehlen, muss dieser Zeitplan zur Digitalisierung (leider wieder) als unrealistisch betrachtet werden. Das Szenario erinnert an frühere Digitalisierungsanstrengungen „Made in Germany“, bei denen Verpflichtungen zur Nutzung voreilig umgesetzt wurden, lange bevor eine effektive Nutzbarkeit gegeben war.
Die digitale Rechnung: Ein Schritt in die Zukunft
Die digitale oder elektronische Rechnung, kurz eRechnung, hat das Potenzial, Geschäftsabläufe zu optimieren, Zeit und Ressourcen zu sparen und die Umweltbelastung zu reduzieren. Die EU hat erkannt, dass die Einführung einer einheitlichen eRechnungsregelung einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung darstellen kann. Geplant ist die Einführung im Jahr 2028, begleitet von umfassendem Reporting, um die Fortschritte zu überwachen und sicherzustellen.
Deutschlands ehrgeiziges Ziel und die Herausforderungen
Deutschland hat ehrgeizige Pläne, bereits ab 2025 eine nationale eRechnungsregelung umzusetzen. Dieses Vorhaben bietet einige Herausforderungen: Zum einen stehen die rechtlichen Vorgaben noch nicht fest. Es bedarf klarer und einheitlicher Richtlinien, um Unternehmen Sicherheit und Rechtsschutz zu bieten. Zum anderen sind die technischen Vorgaben und Standards noch nicht ausgereift. Eine frühzeitige Einführung ohne ausreichend entwickelte technische Grundlagen kann zu Ineffizienzen, Unsicherheiten und möglicherweise sogar zu Rückschlägen führen.
Lehren aus der Vergangenheit – Digitalisierung „Made in Germany“
Die aktuelle Situation erinnert unglücklicherweise an frühere Beispiele der Digitalisierung „Made in Germany“. In der Eile, auf den digitalen Zug aufzuspringen, wurden oft Verpflichtungen zur Nutzung digitaler Lösungen eingeführt, bevor diese ausgereift waren. Die Folge waren häufig unzureichende Funktionalitäten, Kompatibilitätsprobleme und hohe Anpassungskosten für Unternehmen.
Beispiel Kassensicherheit
Ein Beispiel sind die Registrierungspflichten für Kassensysteme, die die Finanzverwaltung bis heute nicht elektronisch annehmen kann. Zudem gab es beim Thema Kassen ein weiteres Problem. Die zur Einführung verbleibende Zeit war für die Hersteller, Softwarehäuser, Berater und Unternehmern letztlich viel zu kurz. Dies lag auch daran, dass es zwar ein Gesetz gab, die Anweisungen, wie dieses Gesetz in die Praxis umgesetzt werden soll, fehlten jedoch.
Als dann endlich sowohl das Bundesfinanzministerium (BMF) als auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) soweit waren, ist viel kostbare Zeit verstrichen. Im Rahmen der Einführung gab es ein weiteres Problem: Die Regelungen waren – steuerlich und technisch – so komplex, dass weder IT-Fachleute noch Steuerberater etwas damit anfangen konnten. Nur durch gemeinsame Arbeitsgruppen konnte das Pensum an Informationen bewältigt und die Einführungsprojekte vorangetrieben werden.
Umsetzung im Wachstumschancengesetz
Die der ZDH berichtet ↗, wurde das Wachstumschancengesetz um einen gestaffelten Zeitplan zur Einführung der eRechnungen ergänzt. Der urprünglich vereinbarte Zeitplan (hier in Klammern) wurde im Rahmen der Beratungen des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages überarbeitet:
- ab 01.01.2025 – jedes Unternehmen wird zum Empfang von eRechnungen verpflichtet (unverändert)
- ab 01.01.2027 – alle Unternehmen mit mehr als 800 T€ Umsatz müssen eRechnungen erstellen (bisher: 01.01.2026)
- ab 01.01.2028 – alle Unternehmen müssen eRechnungen erstellen (bisher: 01.01.2027)
- (bisher: – muss das EDI-Verfahren durch die eRechnung abgelöst werden)
Eine Abschaffung des EDI- bzw. EDIFACT-Verfahrens ist nun nicht mehr geplant. Stattdessen werden wohl Ergänzungen zu den Standards erforderlich sein. Neu ist laut DIHK (Beitrag existiert nicht mehr) zudem, dass der Finanzausschuss die Bundesregierung aufgefordert hat bis Ende 2024 ein kostenloses Angebot zur Rechnungserstellung sowie zum Ansehen elektronischer Rechnungen zur Verfügung zu stellen.
Aussagen des BMF zum weiteren Verfahren
Das Bundesfinanzministerium hat im Rahmen der Verbändeanhörung eine Antwort gegeben (vgl. Website des Deutschen Steuerberaterverbandes (PDF – web.archive.org) ↗) und besteht weiter auf der Umsetzung, sofern keine Änderung im Gesetzgebungsverfahren erfolgt. Zukünftig sollen insbesondere ZUGFeRD (ab Version 2.0.1) und XStandard anerkannt werden, auch weitere Formate, die die Anforderungen der EU erfüllen, sollen anerkannt werden.
Das besonders im Großhandel genutzte EDI-Verfahren bedarf offenbar noch einer Anpassung, damit die Daten auch zukünftig den Anforderungen genügen.
Eine wesentliche Änderung ergibt sich für PDF-Dateien mit eingebetteten Daten. Hier wird zukünftig nicht der – für das menschliche Auge sichtbare – gedruckte Text maßgebend sein, sondern der maschinenlesbare Teil. Es kommt damit zu einer Umkehr der Maßgeblichkeit – sofern denn abweichende Informationen vorliegen. Der Umsatzsteueranwendungserlass (UStAE) wird dann entsprechend angepasst.
Auch die Pflicht zum Empfang elektronischer Rechnungen soll mit Wirkung zum 01.01.2025 bestehen bleiben. Bitte beachten Sie unseren Blogbeitrag zum Empfang von eRechnungen aus 2024.
Fazit zur digitalen Rechnung: Klugheit vor Schnelligkeit
Es ist zu begrüßen, dass nach Jahren Bewegung in das Thema eRechnungen kommt. Die neuen Vorschläge für die eRechnung werfen wichtige Fragen auf, die vollständig geklärt sein sollten. Eine überstürzte nationale Einführung der Regelungen könnte zur erheblichen Mehraufwand für inländische Unternehmer führen. Insbesondere dann, wenn die nationalen Regelungen nicht vollständig mit den finalen Vorgaben der EU abgestimmt sind.
Wenn die Digitalisierung der Rechnungen erfolgreich verläuft, gibt es Regelungen, die europaweit zur Kompatibilität führen. Falls dies scheitert, müssten Unternehmer ggf. je Nationalstaat unterschiedliche eRechnungs-Vorschriften anwenden. Deutschland sollte die Chance nutzen, die Digitalisierung klug und nachhaltig voranzutreiben, um langfristigen Erfolg sicherzustellen. Daher sollte der deutsche Gesetzgeber die (finalen) Vorgaben aus Europa abwarten, um Mehraufwand von den Unternehmen abzuwenden.
Aktualisierungen
09.10.2023: Ergänzung der Fristenregelung und Verweis auf den ZDH
25.10.2023: Ergänzung um Aussagen des BMF und Verweis
20.11.2023: Ergänzung um Änderungen im Gesetzgebungsverfahren, Verweis auf DIHK
04.03.2024: Defekten Link (DIHK) entfernt, Fehler behoben
15.08.2024: Hinweis auf neuen Blog-Beitrag
31.03.2025: Video von Herrn plietsch! ergänzt