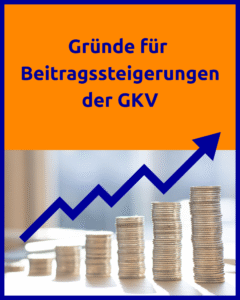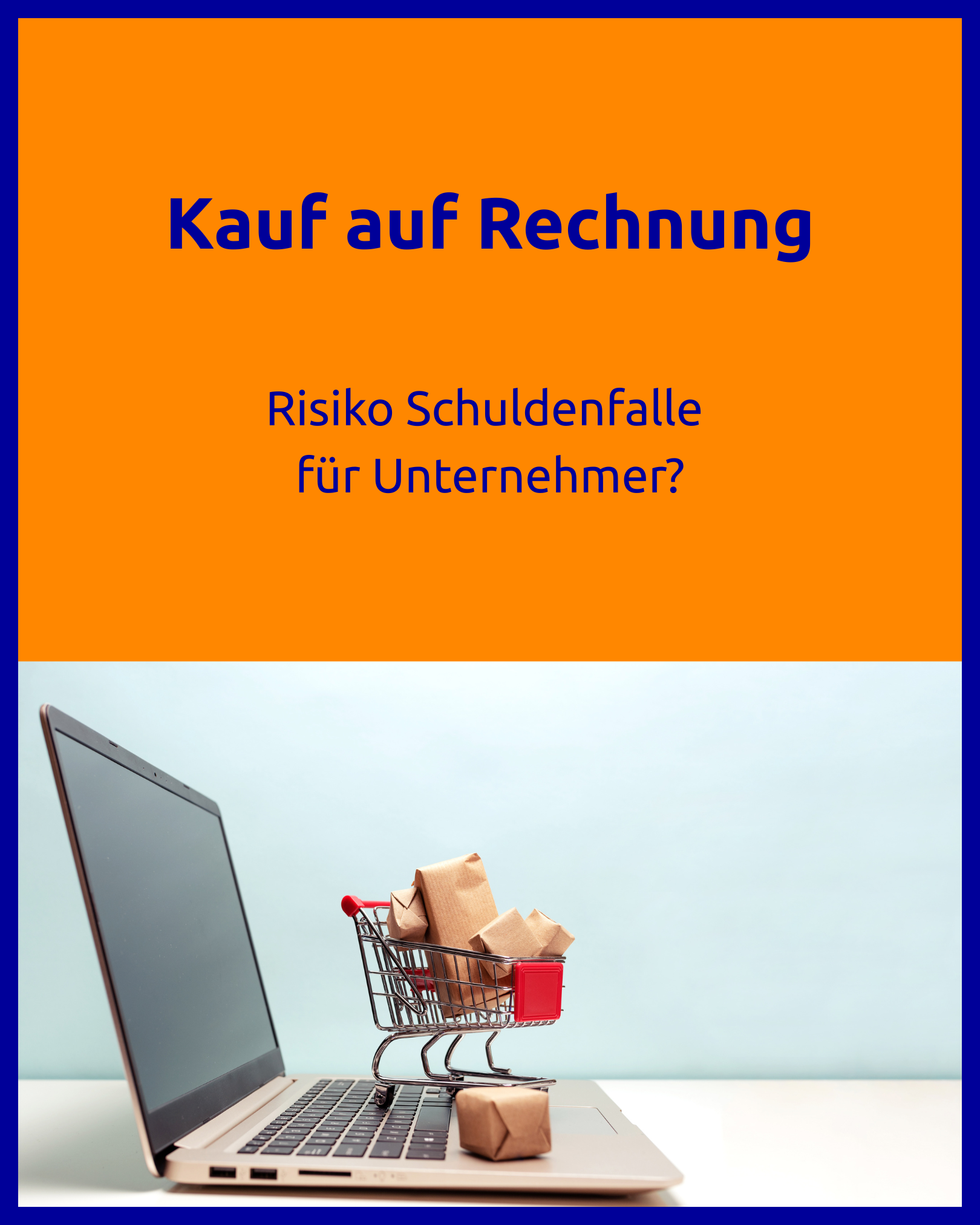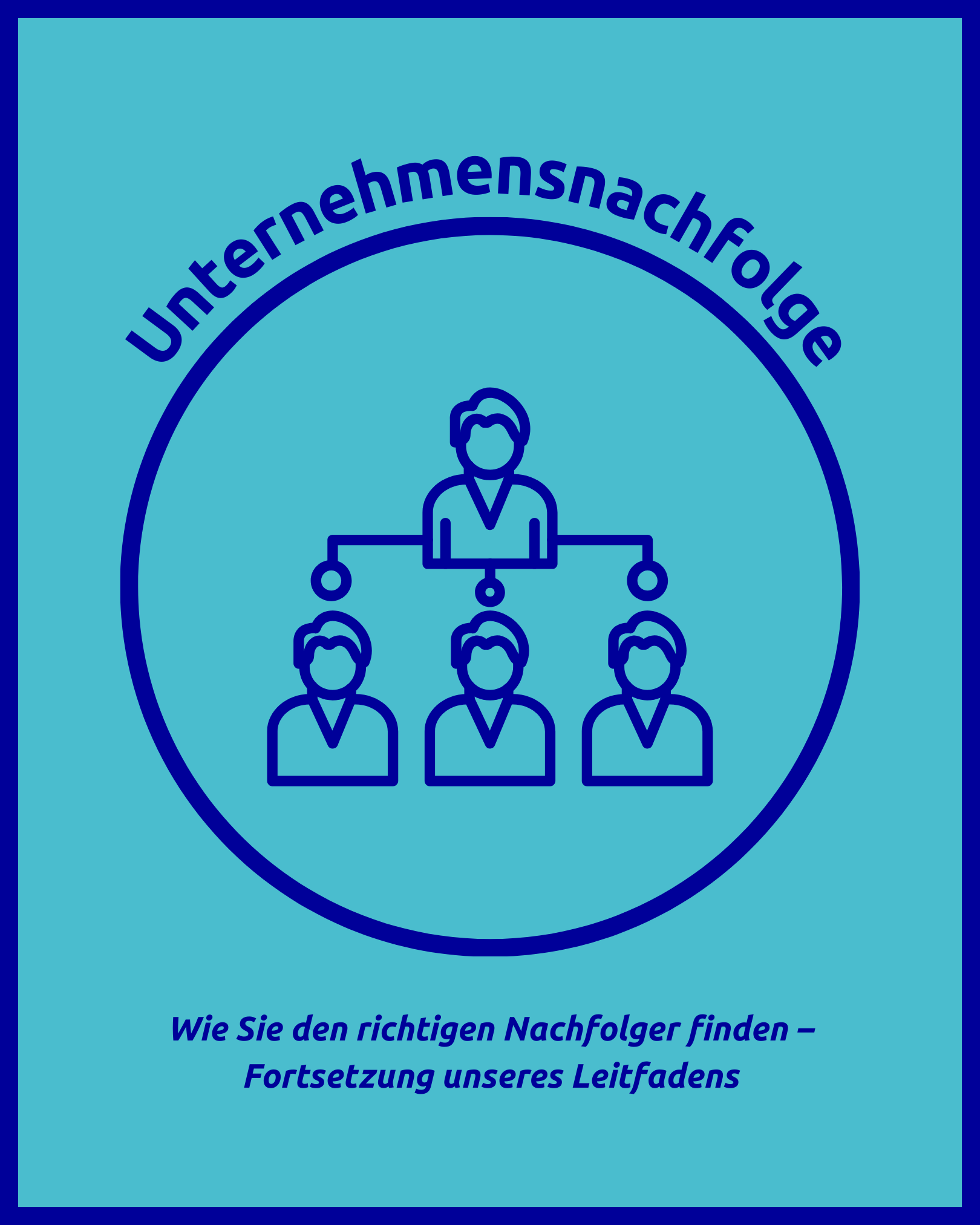Die Beiträge zu den gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland sind in diesem Jahr teilweise mehrfach angehoben worden. Darüber hatten wir bereits Anfang 2025 berichtet. Auch für 2026 wird bereits mit weiteren Beitragssteigerungen gerechnet.
Doch warum steigen die Krankenkassenbeiträge? Neben den Kostensteigerungen im Gesundheitsbereich, liegen den Steigerungen auch politische Ursachen zu Grunde, über die wir hier aufklären wollen.
Bisherige Steigerungen der Krankenkassenbeiträge in 2025
Nach dem Defizit von 6,2 Mrd. € der gesetzlichen Krankenversicherungen in 2024 war eine deutliche Erhöhung der Beiträge in 2025 die Folge. Der vom Gesundheitsministerium geschätzte durchschnittliche Zusatzbeitrag von 2,5 % wurde von vielen Kassen überschritten. In der Folge lag der durchschnittliche Zusatzbeitrag bereits Anfang 2025 bei 2,9 %. Seitdem gab es diverse weitere Erhöhungen einzelner Kassen und ein Ende ist noch nicht absehbar.
In unserem Blogbeitrag zu den Beitragssteigerungen haben wir die unterjährigen Erhöhungen der bundesweiten Kassen aufgeführt. Bereits im April 2025 ging das Institut der deutschen Wirtschaft ↗ von Mehrkosten für die Unternehmen von 3,8 Mrd. € aus.
Ausblick auf 2026 – Höhere Krankenkassenbeiträge
Auch für 2026 wird mit einer weitere Erhöhung der Zusatzbeiträge gerechnet. Nach Schätzung des Verbands der Ersatzkassen sollen diese um weitere 0,5 % angehoben werden.
Sofern dabei vom Beitragsniveau Anfang 2025 ausgegangen wird und nicht vom – offenbar zu niedrig festgelegten Zusatzbeitrag, würde der vom Bundesgesundheitsministerium festgelegte Zusatzbeitrag um 0,9 % im Vergleich zum Vorjahr auf 3,4 % steigen.
Steigende Gesundheitskosten
Ein Teil der Beitragssteigerungen ist im Gesundheitssystem selbst begründet. Hier sind verschiedene Punkte ursächlich.
Fehlende Strukturreformen
Der ehemalige Geundheitsminister Lauterbach (Quelle: FR ↗) gab an: „Das deutsche Gesundheitswesen ist das teuerste in Europa, weil es in vielen Bereichen nicht effizient ist.“ Immer wieder werden die hohen Kosten für Arzneimittel und Krankenhäuser als Problem genannt.
Steigende Kosten
Inflation, Lebenserwartung und neue Behandlungsmethoden oder Medikamente führen oft zu steigenden Kosten im Gesundheitssystem. Wenn die Kosten in diesem Bereich stärker steigen als die durch Lohnerhöhungen steigenden Beiträge, kommt es in der Folge zu einer Erhöhung der Beitragssätze.
Ausgabenmoratorium
Die gesetzlichen Krankenkassen fordern ein Ausgabenmoratorium, damit die Ausgaben der Versicherungen zukünftig nicht stärker steigen als die Einnahmen.
Ursachen außerhalb der Gesundheitskosten
Neben diesen innerhalb des Gesundheitswesens liegenden Ursachen, spielen auch Entscheidungen der Bundespolitik eine entscheidende Rolle bei der Haushaltsentwicklung der Krankenkassen. Diese können die Beiträge sowohl (kurzfristig) senken als auch zu deutlichen Beitragssteigerungen führen.
Abbau des Vermögens verursacht Erhöhung der Krankenkassenbeiträge
Durch einen Kniff des ehemaligen Gesundheitsministers Spahn im Jahr 2018 konnte er Beitragssteigerungen in seiner Amtszeit vermeiden. Er verpflichtete die Kassen schlicht ihre Milliarden an Reserven abzubauen. Dadurch wurden Beitragssteigerungen verschoben bzw. sogar Beiträge gesenkt.
Die Retourkutsche kam nun mit dem Ende der früheren Reserven: Die höchste Beitragssteigerung seit Jahren. Aus Sicht des Vorstands der Techniker Krankenkasse Baas (Quelle. ZDF heute ↗), war das „aber Beschiss, weil einfach die Rücklagen abgebaut wurden.“
Versicherungsfremde Leistungen steigern Beiträge der gesetzlichen Krankenkassen
Bei den versicherungsfremden Leistungen handelt es sich um Aufgaben, die die gesetzlichen Krankenversicherungen vom Staat aufgetragen bekommen haben, die jedoch nicht direkt mit der Krankenversicherung im Zusammenhang stehen. In der Folge tragen die gesetzlich Krankenversicherten diese Last, statt der Gesamtheit der Steuerzahler oder der gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen gemeinsam.
Kosten der Pflege-Ausbildung
Aus Sicht der Krankenkassen sollte der Staat die Kosten der Pflege-Ausbildung tragen, um die Pflegekassen zu entlasten.
Rentenbeiträge für pflegende Angehörige
Um pflegende Angehörige zu entlasten, übernehmen die Pflegekassen die Beitragszahlung in die Rentenversicherung. Grundsätzlich eine wirksame Maßnahme, zumal mehr als 80 % der Pflegefälle von Angehörigen betreut werden. Hier sehen die Krankenkassen jedoch Potential einer Beitragsstabilisierung, wenn diese Kosten nicht mehr von der Pflegeversicherung getragen werden müssen.
Corona-Sonderlasten in der Pflegeversicherung
Während der Corona-Pandemie wurden Sonderlasten durch die Pflegeversicherungen getragen, die bis heute nicht durch den Bundeshaushalt refinanziert wurden. Die Sonderzahlungen an den Bund fehlen nun in Höhe von 5 Mrd. € bei den Pflegekassen.
Krankenhausreform
Bei der von der Ampel-Koalition beschlossenen Krankenhausreform verweigerte die FDP um den ehemaligen Bundesfinanzminister Lindner die Übernahme der hälftigen Kosten durch den Bundeshaushalt. Auch nach dem Bruch der Koalition kam diesbezüglich kein neuer Haushalt zustande. Diese Kosten von rund 50 Mrd. € werden nun – über 10 Jahre verteilt – die gesetzlichen Krankenkassen belasten.
Gegen die dadurch resultierenden Beitragssteigerungen gibt es eine Musterklage des Sozialverband VdK ↗.
Beiträge von Bürgergeldempfängern
Die gesetzlichen Krankenkassen versichern die Bürgergeldempfänger. Der Ausgleich, den die die Kassen hierfür durch den Bund erhalten, ist jedoch um 10 Mrd. € zu gering, wie der Verband der Ersatzkassen im April meldete ↗. Ursache dafür ist auch, dass der Zuschuss seit 2017 nicht mehr angepasst wurde.
Der Sozialverband VdK prüfe wohl eine Klage gegen die fehlende Anpassung des Bundeszuschusses, da dies zu einer Erhöhung der Beiträge führt.
Maßnahmen der Regierungskoalition
Konkrete Maßnahmen sieht der Koalitionsvertrag nicht vor, wie wir berichtet haben. Stattdessen soll zunächst eine Expertenkommission eingesetzt werden, die Möglichkeiten ausarbeitet. Die Ergebnisse sollen jedoch erst 2027 erarbeitet werden, was aus Sicht der Beitragszahler und Krankenkassen zu spät ist.
Darlehen statt Reform
An Stelle kurzfristiger Reformen, die zu einer Stabilisierung der Beiträge beitragen, sollen die Kassen Darlehen aus dem Bundeshaushalt erhalten. Ziel ist eine Zahlung von jeweils 2,3 Mrd. € in 2025 und 2026 für die Krankenkassen und von 0,5 bzw. 1,5 Mrd. € für die Pflegekassen.
Dieses Vorgehen wird von den Krankenkassen moniert, da eine Rückzahlung ab 2029 die Beitragszahler erneut belastet. Dies würde in der Folge einen ähnlichen Effekt haben, wie die Abschmelzung der Reserven durch Spahn und somit nur zu einer späteren Beitragserhöhung führen.
Keine Abschaffung der PKV
Mit der aktuellen Regierung wird es eine Abschaffung der privaten Krankenversicherung (PKV) nicht geben, wie Bundeskanzler Merz deutlich machte (Quelle: AOK.de ↗): „Wenn Sie den Mercedes verbieten, wird der Golf teurer.“
Immerhin wurde das Problem der Leistungen für die Bürgergeldbezieher nun auch durch den Bundeskanzler erkannt, wenn auch keine kurzfristige Lösung in Aussicht steht.
Weitere Fusionen
Mehrere Politiker der Regierungsparteien haben gefordert, die Zahl der Gesetzlichen Krankenkassen weiter zu reduzieren. Diese ist innerhalb der letzten 10 Jahre durch Fusionen bereits von rund 120 auf derzeit 94 zurückgegangen.
Kritisch ist in diesem Zusammenhang, dass gerade bei Kassen mit hohen Beiträgen auch vergleichsweise hohe Krankheitskosten anfallen dürften. Dies macht eine Fusion für die übernehmende Kasse nicht attraktiv; Mehrkosten müssten dann durch anderen Kassen gemeinsam getragen werden, was bei weiteren Kassen zu Beitragserhöhungen führen könnte. Über diese Systematik hatten wir bereits an anderer Stelle berichtet.
Leistungskürzungen
Sowohl Bundeskanzler Merz als auch Bundesfinanzminister Klingbeil haben Leistungskürzungen als Alternative zur Stabilisierung der Krankenkassen ins Spiel gebracht, wie inFranken.de berichtet ↗. Die Debatte ging soweit, dass der Drogenbeauftragte der Bundesregierung und Gesundheitspolitiker der CDU, Hendrik Streeck, von Überversorgung bei Hochbetagten gesprochen hat und überlegte diesen teure Medikamente nicht mehr zukommen zu lassen, wie die tagesschau berichtete ↗.
Bundesgesundheitsministerin Warken (CDU) hat das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege um ein „kleines GKV-Sparpaket“ erweitert. Doch dadurch ist dieses Gesetzt in der Bundesratssitzung vom 21.11.2025 nicht verabschiedet worden. Die Länder haben wegen befürchteter Verluste bei den Krankenhäusern den Vermittlungsausschuss angerufen, wie der Bundesrat berichtet ↗.
Durch die Anrufung des Vermittlungsausschusses kommen die potentiellen Erleichterungen für die Krankenkassen vermutlich zu spät, um noch bei der Kalkulation der Beitragssätze berücksichtigt zu werden. Dies kritisiert der GKV-Spitzenverband ↗ in einer ersten Reaktion auf die Anrufung des Vermittlungsausschusses.
Forderungen der Krankenkassen zur Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge
Aus Sicht der Krankenkassen (hier: Magazin des Verbands der Ersatzkassen ↗) sind strukturelle Anpassungen und kurzfristige Maßnahmen bereits in 2025 erforderlich. Bereits unter der Ampel-Koalition konnte keine Einigung erzielt werden. Damit sich die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen nicht weiter erhöht, sollte nicht bis 2027 gewartet werden.
Eine immer wieder geforderte Maßnahme ist die Senkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel von 19% auf 7% (KBB-Dachverband ↗).
Die Techniker Krankenkasse hat einen 10-Punkte-Plan (PDF ↗) vorgelegt, mit dem jährliche Einsparungen von 8,3 Mrd. € möglich wären. Dies entspricht nach eigener Aussage 0,4 % Beitragssteigerungen.
Die Kürzung der Leistungen wird demgegenüber abgelehnt, da diese sich am Anspruch des Sozialgesetzbuchs orientieren „notwendig, zweckmäßig und wirtschaftlich“ zu sein. Alternativ könnten aus Sicht der Kassen die Ausgaben auf die Einnahmen gedeckelt werden. Diese Maßnahme würde wiederum dazu führen, das die Leistungserbringer Kürzungen hinnehmen müssten.
Kritik vom DGB
Der Deutsche Gewerkschaftsbund ↗ stellt fest: „Flickschusterei löst das Problem jedenfalls nicht.“ Er fordert einen höheren Bundeszuschuss an Stelle von Darlehen sowie den Übergang zur Bürgerversicherung.
Klage des GKV-Spitzenverbandes
Wie der GKV-Spitzenverband in einer Pressemitteilung ↗ verlauten lässt, soll noch in 2025 Klage gegen die zu geringen Zuweisungen für die Kosten der Bürgergeldempfänger erhoben werden. Gegenstand der Klage soll die Unterfinanzierung aus dem Bundeshaushalt in Höhe von 10 Mrd. € für das Jahr 2026 sein. Es wird durch die Krankenkassen mit einem langwierigen Verfahren gerechnet, das am Ende bis vor das Bundesverfassungsgericht gehen könnte.
Ziel der Klage ist es, dass die vollständigen Kosten aus dem allgemeinen Bundeshaushalt getragen werden und nicht zu Lasten der paritätisch finanzierten Krankenkassen.
Entschließung des Bundesrats
Der Bundesrat hat auf seiner Sitzung am 30.01.2026 eine Entschließung verabschiedet. Mit dieser wird die Bundesregierung aufgefordert sämtliche versicherungsfremden Leistungen aus Bundesmitteln zu finanzieren und damit die Krankenkassen zu entlasten. Dies gilt neben den bereits genannten Beiträgen für Bürgergeldbezieher unter anderem auch für die Rentenversicherungsbeiträge pflegender Angehöriger. Der Antrag des Landes Baden-Württemberg wurde einstimmig durch den Bundesrat verabschiedet.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) begrüßte die Entschließung und geht von 45 Mrd. € pro Jahr aus, die den Kassen so aus Bundesmitteln zufließen würden. Damit wären aus Sicht der Ärztevereinigung auch die „Diskussionen über schmerzhafte Leistungseinschnitte“ vom Tisch.
Fazit
Während die Scheinreform unter Bundesgesundheitsminister Spahn das Problem nur verschlimmert und verschoben habt, besteht nun dringender Handlungsbedarf. Das System ist jedoch äußerst komplex und ein großer Wurf kurzfristig nicht zu erwarten. Die beste Unterstützung der Kassen wäre sicherlich, wenn die Beiträge für die Bürgergeldempfänger Kosten deckend wären, doch das scheint derzeit nicht in Aussicht zu stehen.
Aktualisierungen
04.02.2026: Ergänzung der Entschließung des Bundesrats
27.11.2025: kleines Sparpaket ist im Bundesrat gescheitert; Reaktionen der Krankenkassen
18.11.2025: Ergänzung der Klage des GKV Spitzenverbandes gegen die zu geringen Zuschüsse für Bürgergeld-Empfänger
20.08.2025: Aufnahme der Forderungen von TK, BKK Dachverband und DGB